Zuerst ein paar Worte über "das Schöne". Jahrtausende ist der Begriff des Schönen immer wieder untersucht worden. Das Empfinden des Schönen ist ein elementares Erleben des Menschen, und wenn es fehlt, fehlt ein wesentlicher Teil unseres Menschseins.
Das Schöne erleben wir in den unterschiedlichsten Weisen. Ein schönes Essen, eine schöner Abend, ein schönes Konzert, ein schönes Fußballspiel, ein schönes Gespräch. Immer kann man dieses Wort dann anwenden, wenn es darum geht, etwas zu bezeichnen, was in seiner Weise stimmig war, was uns ein Empfinden, der Ausgewogenheit, des gleichwohl Spannenden, des Lohnenswerten vermittelt hat. Das Schöne kann einen so ergreifen, dass man weinen muss, und manchmal kann man dem Schönen selbst gar nicht standhalten, so eine Wucht kann es haben. Aber es ist auch wieder ganz leise, ganz unbemerkt stellt es sich ein, und man antwortet darauf mit einem leichten Schmunzeln.
Über das, was schön ist, kann man streiten, denn "die Geschmäcker sind verschieden". Wat dem ihnen sin Uhl ist dem andern sin Nachtigall.
Das Schöne ist dann auch immer schnell wieder vorbei, man möchte es festhalten, einfangen. der Alltag hat uns wieder. Um das Schöne zu verlängern, wurden ganze Industrien entwickelt, Von der Fotografie, über die Schallplattenindustrie, die Mode, und damit der ganze dazu gehörige Medienmarkt. Denn im Schönen kann man auch abtauchen, kann sich darin verlieren, das Schöne ist oft irgendwie eine andere Welt, als das, was uns hier im Irdischen alle Tage geschieht. Wohl dem, der es sich leisten kann, sich immer mit Schönem zu umgeben. Aber hat er dann auch eine schöne Seele?
Lassen wir es bei diesen Gedankensplittern. Aus der Sicht der Zeichenkritischen Theorie ist das Schöne eine Wahrnehmungsweise. Es ist also eine Mischung aus Wahrnehmungstendenzen, die sich bei jedem Individuum in einem besonderen Mischungsverhältnis darstellen kann.
Grundsätzlich gehören dazu die ästhetische, die tiefensymbolische, die ikonische, die individualsymbolische, die sprachsymbolische und die abstrakte Wahrnehmungstendenz. Kein Wunder, wenn man sich bei den daraus entstehenden Mischungsverhältnissen nicht einig werden kann , was es denn nun ist, das Schöne.
Das Schöne hat kein eigenes Sein. Es ist ein Zusammenklang zwischen O' und O, natürlich auch O'' und O''''. Und dieser Zusammenklang geschieht. Meistens unerwartet. Vielleicht ist Kunst und Kultur mit deswegen entstanden, weil man diesen Zusammenklang dann wenigstens versuchen konnte zu beeinflussen. Wir müssen das Schöne erfassen, müssen es in uns wirksam werden lassen. Und damit hat es fast den Charakter eines O''', wenn es sich dabei um Kommunikation handelt.
Das Wesentliche dabei ist, das wir das Schöne wahrnehmen. Mit allen Möglichkeiten unserer Wahrnehmung.
Ästhetisch erleben wir das Schöne als den schönen Augenblick (ganz im Sinne Fausts), als einen Moment, den es gilt, mit allen Sinnen zu erfassen, jetzt, denn im nächsten Moment ist vielleicht alles schon wieder vorbei...
Tiefensymbolisch erleben wir das Schöne vielleicht als das uns Ergreifende, ein gewaltiges Naturereignis, es ist die Katharsis der griechischen Tragödie, die Ruhe nach dem Sturm.
Ikonisch erleben wir das Schöne natürlich im Kennen, in dem Wunsch, die Lieblingsplatte - ach nein, die Lieblings-CD - immer und immer wieder zu hören, die Fotoalben von der wunderschönen Urlaubreise immer und immer wieder durchzublättern. Außerdem gibt uns das Ikonische den Mut, dem überwältigend Schönen auch standzuhalten, nicht davonzulaufen vor dessen Wucht.
Individualsymbolisch erleben wir das Schöne im Wissen um das, was wir selbst Schön finden, die Lieblingsfarben und die Lieblingsgerichte, als das, was man sich gerne anzieht, als die kleinen Rituale des Wohlergehens....
Sprachsymbolisch erleben wir das Schöne in den gesellschaftlich vorgegebenen Schönheitstempeln, vom Museum angefangen bis hin zur Wahl der "Miss Germany", wir erleben das Schöne in den Regeln der Komposition und des gesellschaftlichen Anstands, im inszenierten Arrangement des Konzertbesuchs bis hin zum Autosalon.
Abstrakt erleben wir das Schöne möglicherweise am intensivsten: Es ist eben jenes Empfinden des Stimmigen, was in den andren Wahrnehmungstendenzen nur konkret in Erscheinung tritt. Ohne dieses Stimmige wird aus dem Erleben mit den andren Wahrnehmungstendenzen lediglich eine banale Konkretion. Das Abstrakte ist als Erfahrung der existentiellen Konstanten "natürlich" direkt mit O verknüpft. Dieses O, welches auch die Basis unseres Menschseins ist (als Menschen sind wir dann vielleicht die Konkretion unserer Wirklichkeit), ist auch die Basis des Schönen, wenn wir uns in Einklang mit dieser Basis befinden. Deswegen lieben wir so den schönen Körper, und auch die Schönheit des Alters, die abgeschmirgelt wurde durch Zeit und Schicksal.
Ein Bild (und natürlich die Kunst als Ganzes) kann viel von diesem Schönen wiedergeben, im Bild können wir dieses Schöne erfassen. Auch hier ist die Basis das Abstrakte, die Ausdrucksqualität der bildnerischen Variablen als Äquivalente der existentiellen Konstanten gibt uns Zugang (wenn wir es denn wahrnehmen wollen) zu dem stimmigen Zusammenhang von Formulierung und Inhalt. Ist der Inhalt - oder "das Motiv" nicht im Einklang mit diesem abstrakten Gerüst, erscheint uns das Bild vielleicht interessant, auch bewegend, auch cool oder geil, aber schön ist es dann noch nicht. Es ist eine Konkretion zwischen Amüsement, "Unterhaltung" und Kitsch.
Wir umgeben uns tagtäglich mit Bildern, Sie hängen an den Wänden, sind eingeschlossen in Büchern, wir tragen sie mit uns herum im Portemonnaie, wir schauen sie an im Museum. Sie sind Dekoration unserer Lebenswelt, Repräsentanten unserer Selbstvorstellung, Affirmationen unseres Kulturverständnisses. Bilder gehören zu unserem Leben dazu, als Foto, als Plakat, als Cover einer Illustrierten, als Bild auf dem Geldschein. 85% unseres Wahrnehmungsapparates sind auf visuelle Reize aus gerichtet, und unser Bewusstsein wird immer wieder durch den Wettbewerb der unterschiedlichsten Bildwelten in Trab gehalten. Aber "erleben" tun wir solche Bilder eher nicht. Auch wenn wir durch Kunstausstellungen pilgern, uns in kürzester Zeit von einem Bild zum nächsten schieben, leben wir nur das Ritual einer Begegnung mit Kunst.
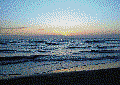 |
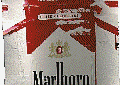 |
Ab und zu fesselt ein Bild doch unseren Blick so, dass wir einen Moment stoppen, dass wir plötzlich überrascht sind. Wir halten inne. Und dieses innehalten ist ein Moment, der kostbar ist, er ist überraschend, immer neu. Im Wort "innehalten" steckt einmal das 'halten' als "mit der Bewegung aufhören" und gleichzeitig das "etwas nicht mehr loslassen" wollen. Beides gehört zum Erleben eines Bildes, wenn es denn ein Bild ist. Denn nur Bilder, die "dieses gewisse Etwas" haben, die in uns etwas zum klingen bringen, was mehr ist als nur der Bezug zwischen dem Bild und dem Betrachter (O'-O''), können dieses innehalten bewirken. Und dann steckt in diesem Wort noch das "inne" - "innen". Es ist ein "Innen etwas zur Ruhe bringen" und "innen etwas festhalten". Das Festhalten ist auch der Begriff für etwas "Gelerntes", etwas, was wir von jetzt an festhalten können, weil wir es verstanden haben. Das Bild setzt etwas in uns in Bewegung, etwas verändert sich.
Mit einem Bild sich beschäftigen
Man kann dieses Erlebnis auch provozieren. Nicht immer. Man muss sich dazu auch in eine Lage versetzen, die diese Ruhe erlaubt, die Innehalten möglich macht. Sich Zeit lassen. Sich einlassen. Dieses "sich einlassen" ist weder aktiv noch passiv, es ist beides. Man ist bereit, dass man eingelassen wird. "Dieses Tor war nur für Dich bestimmt" sagt der Türhüter von Kafka. Es ist ein Geschehenlassen, ein aktives Warten, welches die Seele freimachen kann für Unerwartetes.
Die Beschäftigung mit Kunst hat immer auch ein Ziel, eben das Ziel einer Bewusstseinserweiterung, einer Weiterentwicklung der eigenen inneren Welt. Wer Kunst nur deswegen schön findet, weil er sich darin bestätigt fühlen will, wer Kunst nur als Selbstdarstellung gebraucht und nur das für Kunst hält, was ihm selbst gefällt, der wird wenig von dem erleben, was Kunst tatsächlich vermitteln kann.
Kunst ist selbstverständlich auch Affirmation. Den Gleichklang erleben im Betrachten eines Bildes zwischen sich selbst und dem, was das Bild einem zeigen kann, ist ein 'schönes' Erlebnis. Es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn Kunst einem gut gefällt. Dabei kann auch die Überraschung erlebt werden, dass man sich selbst im innehalten wieder bewusst wahrnehmen kann. Insofern kann Kunst auch meditativ erlebt werden. Man sollte sich alle Wege zu Kunst offen halten.
In Lektion .. gibt es einige Gedanken zum "Umgang mit Kunst". Eines will ich hier noch deutlich machen: Man sollte sich nicht scheuen, auch ein oder mehrere Bilder zu besitzen. Die Frage danach, ob sie es auch "wert" sind, kann man letztlich nur selbst beantworten. Der Kunstmarkt führt einen mit Sicherheit an der Nase herum. Dort geht es nämlich nicht um Erkennnistinteresse sondern um Rendite.
Sammelt Kunst! Und sammelt Kunst, die noch nicht in aller Munde ist. "Sichere Werte" sind etwas für Spekulanten und Museen. Und wie "sicher" diese Werte wirklich sind, bleibt häufig fragwürdig, wenn man die Kunstgeschichte betrachtet. Die mutigen Sammler, die sich früh auf ihr Empfinden verlassen haben, und Bilder von den Impressionisten, der klassischen Moderne, vom Informel und anderen heute "anerkannten" Kunstrichtungen gekauft haben, hatten damals alles andere als ein Gefühl "sichere Werte" zu besitzen. Aber sie hatten ein sicheres Gefühl.
Manchmal muss man ein Bild näher untersuchen, um dahinter zu kommen, was es einem sagen kann. Die Gefahr beim Bilder gucken ist ja auch immer, dass wir nur das sehen, was wir sehen wollen. Und vielleicht steckt ja noch viel mehr oder etwas ganz anderes hinter dem Bild. Man wir in der Regel nie eine gültige Antwort darauf finden "was einem der Künstler damit sagen wollte", aber man wird durch eine Bildanalyse wesentlich tiefere Einblicke entdecken, als wenn man oberflächlich hinschaut, und sich seinen eigenen Projektionen überlässt. Dazu muss man zweierlei sagen:
man kann ein Bild nie vollständig analysieren.
Man kann ein Bild immer nur aus dem Verständnis heraus analysieren, welches man selbst gegenwärtig hat.
In der Zeichenkritischen Theorie spreche ich deswegen von der "subjektiven Analyse". Diese ist deutlich davon zu unterscheiden, dass man nach Belieben dem Bild Interpretationen aufzwängt, sondern im Bewusstsein der eigenen Position so genau wie möglich, auf Grund des bildnerischen Bestandes und des eigenen Wissens und der eigenen Assoziations- und Empfindungsfähigkeit, versucht dem Bild möglichst aufschlussreiche Aspekte zu entlocken.
Ein Kunsthistoriker, ein Kunstwissenschaftler und ein Kulturjournalist machen auch nichts anderes, allerdings haben diese auf Grund ihres Fachwissens auch Zugang zu nicht ohne weiteres wahrnehmbaren Inhalten, insbesondere zu Hintergründen der Zeit- Kunst- und Individualgeschichte des Künstlers und damit des Werkes.
Man muss auch nicht jedes Bild analysieren, es reicht, dieses ab und zu zu machen, dann wird schon dadurch der Blick so erweitert, dass man Übung bekommt im differenzierteren Sehen.
Was will man über das Bild wissen?
Manchmal ist es so, dass das Geheimnis eines Kunstwerkes sich ganz anders als durch eine Analyse eröffnet. Die Analyse ist kein Werkzeug, um sich den Genuss der Fülle eines komplexen Kunstwerkes vollständig zu erschließen. Eine Analyse dient aber dazu, die verschiedenen Erkenntnisebenen, über die man verfügt, zu aktivieren. Es gibt eben nicht nur die sinnliche und die emotionale Erkenntnis, sondern auch die rationale. Und alle Ebenen gehören für die menschliche Erkenntnistätigkeit zusammen. Sie sind Ausdruck unterschiedlicher Wahrnehmungsintentionen. Wenn man ein Kunstwerk auch analytisch betrachten kann, wenn man es gelernt hat, auf die Einzelheiten einer Gestaltung einzugehen, dann schärft das auch die emotionale und sinnliche Wahrnehmung. "Es fällt einem plötzlich etwas ein", was einem ohne den analytischen Blick nicht aufgefallen wäre.
'Analyse' heißt "In Einzelteile zerlegen". Dies kann kann aber nicht das Ziel einer Analyse sein. Man muss die Einzelteile auch wieder zusammensetzen, muss sich ein Modell machen, wie alles zusammengehört. Das ist eine individualsymbolische Arbeit, und deswegen wird ein anderer Mensch auch zu anderen Ergebnissen kommen. Es gibt keine "richtige" oder "falsche" Analyse oder Kunstbetrachtung. Und was ein Herr Professor in einem Buch über ein Bild schreibt, ist erst einmal nicht "richtiger", sondern allenfalls "fachkundiger". Und vielleicht sitzt dieser Fachmann seiner eigenen vorgefassten Meinung ebenso auf, wie man selbst das normalerweise tut, und sieht deswegen andere Aspekte des Bildes gar nicht. Es ist durchaus möglich, dass ein Laie etwas sieht, was der Fachmann überhaupt nicht (mehr) wahrnimmt.
Was ist Kunst? Wer hat sich diese Frage noch nicht gestellt. Immer wird behauptet, dass man das sowieso nicht sagen könne, denn das was unter Kunst verstanden wird, sei immer wieder etwas anderes. Der Kunstbegriff hat sich in der Tat immer wieder gewandelt, und heute kann man sagen "alles ist Kunst" und "jedermann ist ein Künstler". Das ist natürlich genauso unbefriedigend wie ganz genau zu definieren, was Kunst den sei.
Wenn alles und jedes Kunst ist, dann gibt es daraus auch keinen Erkenntniswert abzuleiten. Dann ist der der gnadenlose Subjektivismus ausgerufen. In einer Gesellschaft, in der sowieso die Erkenntnis gegenüber der Unterhaltung keinen großen Stellenwert mehr hat, ist so eine Haltung nicht unerwartet. Man überlässt die Lenkung der gesellschaftlichen Entwicklung dann besser den Sozialdesignern und Politökonomen. Die werden uns schon eine lebenswerte Welt vor die Füße legen. Solange sie an unser Geld herankommen schon. Zumindest eine unterhaltsame Welt werden sie zu basteln versuchen. Aber wehe, wenn uns plötzlich auffällt, dass Unterhaltung nur die halbe Miete ist.
Also doch KUNST?
Ich glaube schon. "Künstler" sind in unserer Gesellschaft verkommen zu Hampelmännern und Clowns. Ihnen wird das Stückchen Freiheit gelassen, was dem aufrechten Bürger schön längst genommen ist: seine Phantasien zu verwirklichen. Phantasie ist etwas eminent Individualsymbolisches, es ist die Fähigkeit aus dem, was man erkennt, eine Ordnungsstruktur - manchmal auch eine Unordnungsstruktur - zu entwerfen. Um den Künstler diese Rolle schmackhaft zu machen, gaukelt man ihnen möglichen Ruhm und Ehre vor. Natürlich bezahlbar in bar. Eben in der Universalwährung unserer Gesellschaft. Wie viele Tausende von Künstler rackern sich heute ab, um "berühmt" zu werden?
Die Phantasie kann aber auch noch etwas anderes: Sie kann tatsächlich in dem sich ständig wandelnden Bild der Wirklichkeit neue Ordnungsmuster erkennen, kann diese erst einmal "sehen" (der 'Seher' war früher ein ganz wichtiger Mensch in einer Gemeinschaft), und dann kann er für das, was er da sieht, eine Sprache finden. Beides sind Aufgaben, die der Künstler 'eigentlich' hat. Und dann ist der Künstler auch wieder eine Person im gesellschaftlichen Leben, die man braucht, da sie neue Entwürfe, neue Perspektiven entwickeln kann, und nicht nur der Kasper.
Das verbindet den Künstler grundsätzlich mit dem Wissenschaftler: auch dieser forscht an den Grenzen des Wissens herum, er entwickelt Theorien, macht Versuche, um zu verifizieren oder zu falsifizieren. Er versucht immer wieder neue Standpunkte der materiellen Wirklichkeit gegenüber einzunehmen, um der Welt ihre Geheimnisse zu entlocken, dafür muss der Wissenschaftler spielen, muss albern sein, muss auch völlig blödsinnigen Gedankengängen sich verschreiben, denn nur so kommt man nach dem hundertsten Experiment dann doch auf eine Fährte, die weiterführt. Wie viel Zentner Müll haben die Wissenschaftler produziert, Müll, den man nie wahrgenommen hat, weil er rechtzeitig im Schredder verschwunden ist, aber auch Müll, der die Welt an den Abgrund des Erträglichen gebracht hat.
Von Picasso gibt es den Spruch, er habe als junger Künstler sein Atelier mit den Skizzen beheizt, die er als misslungen betrachtet habe...
Welche Rolle spielt die Rezeption?
Und dann kommt bei der Kunst es immer darauf an, wer es in die Hände bekommt. Die Rezeption ist hier eine entscheidende Instanz für das Wirksamwerden von neuen Ideen, die sich in der Kunst manifestieren. Die Rezeption ist deswegen eine entscheidende Instanz, weil es sich bei der Kunst anders als bei der Wissenschaft um Kommunikation handelt. Da braucht es immer einen, der dies als Botschaft wahrnimmt. So erst kann die individualsymbolische Tätigkeit des Künstlers in die Sprachsymbolik integriert werden. Da stellt sich heraus, dass es doch immer wieder den Menschen braucht, der die Ideen, die sich auf einem Kunstwerk entfalten, selbst schon intuitiv wahrgenommen hat, und das Bild als Ausdruck dieser unbestimmten Wahrnehmung erkennt. Es kann ebenso der unbekannte Sammler sein, wie der Kunstkritiker, der plötzlich einen bis dahin unbekannten Künstler "entdeckt".